12 2021
After production (of your own satisfaction)
1.
Das Kino hatte schon immer eine Obsession mit dem Publikum. Daher will ich für meine Überlegungen zu „after audience“ vorwiegend das Kino und audiovisuelle Medien heranziehen. In der Frühzeit des Kinematographen und der Kintopps[1] witterten Bildungsreformer, Sittenwächter und Zensoren im Kino bereits zu seiner Frühzeit etwas Unanständiges oder Ungeheuerliches – nicht so sehr wegen seiner Inhalte, sondern wegen seiner ganz und gar heterotopischen Qualität als sozialer Raum. Dieser verhieß gerade infolge seiner Verwischungen, Vermischungen und Verdunkelungen die Entstehung neuer Formen von Erfahrung, von Sehen und Gesehenwerden jenseits bürgerlich-kultureller Einhegung. 1913 schrieb Emilie Altenloh in ihrer Studie zur Soziologie des Kinos, die auf einer 1911 in Mannheim durchgeführten Datenerhebung beruht, dass für die Mehrzahl der Kinogänger*innen nicht die Qualität der Filme das Bedeutungsvolle sei, „sondern andere Motive bestimmen sie, in die Kinematographentheater zu gehen. Wirkliches Interesse an den Darbietungen bildet am häufigsten noch bei Kaufleuten und bei Frauen die wahre Anregung. Bei ganz wenigen ist die Freude daran aber stark genug, um sie zu veranlassen, allein in den Kino zu gehen; nur einzelne Junggesellen greifen wohl aus Langeweile einmal von sich aus zu diesem Rettungsanker. Für die Verheirateten gibt die Frau, häufiger noch für die jungen Leute das Verhältnis und die Anregung dazu. Für den begleitenden Herrn ist ‚sie‘ dann aber angeblich mehr das Objekt der Beobachtung als die Vorgänge an der weißen Wand. ‚Sie ist immer bis zu Tränen gerührt‘, und überhaupt sind psychologische Studien an den Besuchern, noch häufiger an den Besucherinnen, vielen weit amüsanter als die Films und für viele ein Grund, hin und wieder eine Stunde im Kino zu verbringen.
Fragt man all diese Besucher, warum sie eigentlich in den Kino gehen, so zucken sie meist die Achsel. ‚Faute de mieux‘, antwortete einmal eine Dame. Dieses ‚mieux‘ sieht aber nun für die einzelnen sehr verschieden aus. Jedenfalls vereinigt der Kino von allem genug in sich, um es zu ersetzen, und damit gewinnt er eine mächtige Wirklichkeit, vor der alle Fragen, ob sein Dasein gut oder schlecht oder überhaupt berechtigt sei, nutzlos sind.“[2] Die fundierende Geschlechtsspezifik des potentiell anrüchigen oder gar amoralischen Kinogangs macht auch eine Werbung für das Kino von 1919 deutlich, die Bodo Kensmann in seinem Text „Film – Wirklichkeiten nicht nur zitiert, sondern auch abdruckt, vielleicht um dieser Einsicht besonderen Nachdruck zu verleihen: „Take your girlie to the movies (if you can't make love at home)“[3]
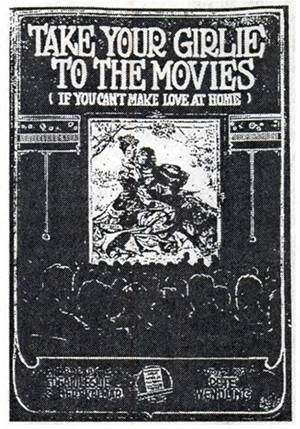
Nicht nur die Frage nach der gebildeten oder ungebildeten, nach der zum nach vorne Sehen erzogenen oder keineswegs disziplinierten Zuschauer*in[4], sondern vor allem das Publikum hat – als Subjekt und Objekt der Reflexion – die Bildung der Filmtheorie bewegt und herausgefordert, wobei es, wie die Filmwissenschaftlerin Heide Schlüpmann argumentiert, mit fortschreitendem Deutungsanspruch der Filmtheorie ironischerweise gerade ins Verborgene geraten sei.[5] Schlüpmann fasst das Publikum als jene schwer fassbare „Affinität unter Lebendigem, die sich im Kino herstellt, also die Bildung eines Zusammenhangs“.[6] Dieser Zusammenhang zwischen dem Leben vereinzelt Schauender und einem Leinwandgeschehen, einer Materialität im Geschauten läuft der (Film-)Theorie, die dem Primat der Erkenntnis und des Kognitvismus‘ oder der Abstraktion als Phänomenologie oder Psychoanalyse etc. folgt, entgegen. Denn wenn sich eine „Affinität der Einbildungsvermögen“ zwischen Kinogänger*innen anbahnt, so beobachtet Schlüpmann konzise, dann gehen die Personen eher unter als dass sie zu Träger*innen oder Subjekten von Dialogen würden. – In diesem Sinne lasse sich beim Publikum auch keinesfalls notwendigerweise von Öffentlichkeit sprechen.[7] Es sei die Erkenntnis, die die (Film-)Theorie vom Kinopublikum trenne, behauptet Schlüpmann. Das Publikum beginne nicht aus Erkenntnisinteresse zu denken. Ihm gehe es darum, zu leben.[8] Wenn „leben“ diese oft als magisch beschriebenen Momente im Kino meint und jene schwer zu benennenden Erfahrungen von Dis-/Kontinuität im Kino und als Kino, dann ist das Publikum der Ort, an dem die Begrifflichkeiten verunsichert und denen daher ein utopisches, immer aber auch ein gewaltsames Moment anhaftet.
2.
After production (of your own satisfaction) könnte auch heißen: Was folgt auf dem prosumer oder liegt außerhalb der Reichweite seiner/ihrer* vermeintlich schwanzverzehrenden autarken Ouroboros-Kondition? Das Kofferwort prosumer[9] bezeichnet ja eine* Verbraucher*in (im Sinne eine*r Konsument* in), die* zugleich Produzent*in ist, so dass ihre Gestalt einen scheinbar geschlossenen Kreis bildet. Und inzwischen sind verschiedene Weiterführungen im Gespräch wie „professionists“ oder auch die „Produtzung“. Für den Bereich semiprofessioneller[10] intellektueller und audiovisueller Erzeugnisse besonders stark verbreitet: der so genannte User-Generated-Content, ein Begriff, der dem Einzugsbereich von cultural and creative industries, digital labour und vor allem unbezahlter Arbeit entstammt. Für die damit einhergehenden Existenzbedingungen und (widerständigen) Subjektivitäten hat das Milieu prekärer Kulturproduzent*innen allerdings immer nach Artikulationsformen gesucht. Wer immer auf Kunst- und Kulturveranstaltungen ausgeht, kennt auch das: Nicht bloß, dass etwa eine künstlerische Werkgestaltung durch Einbeziehung des Publikums zum Kunst-Prosum wird, sondern, dass gerade die kritischen dieser Milieus sehr eng aufeinander bezogen und miteinander verstrebt produzieren und konsumieren – also ihr Leben organisieren. Was hier einmal hieß, auch das eigene Publikum erfinden zu müssen, nennt sich nun audience development. Diese begriffliche Verwischung ist natürlich provokativ gemeint, denn die Aufmerksamkeit, die im audience development erzeugt wird, hat mit der Erschließung neuer Märkte und Quantifizierungen zu tun – im Kino wird das etwa wirksam als so genanntes Neurocinema, die Zirkulation von Filmen, in deren Entstehungsprozess das neurologische Feedback eines Testpublikums eingeflossen ist[11] –, während 'wir' vor allem über Formen der Subjektivierung und der Lebensführung gegen und/oder außerhalb von Kapitalzusammenhängen und gesellschaftlichen Hierarchisierungen nachzudenken versuchten. – Etwa im Sinne einer Politisierung der eigenen Lebens- und Arbeits-Zusammenhänge und als Auslotung deren politischer, sozialer und ästhetischer Potentialitäten haben ‚wir‘ uns (so ab Ende der 1990er Jahre und im Zuge der Debatten um Prekarisierung) als Kulturproduzent*innen bezeichnet.[12] Zu dieser Zeit versuchten ‚wir‘ uns nicht zuletzt auch mit feministischen Leseweisen der Schriften Michel Foucaults zu beschäftigen und haben uns kritisch auf das Auftauchen von Körpern im Feld des Sichtbaren als Objekten der Disziplinierung bezogen.
In seiner Vorlesung vom 14. März 1979 über den Neoliberalismus als Seins- und Denkweise und die Bedeutung der Entstehung des Humankapitals hebt Foucault heraus, dass die Neoliberalen den von der klassischen Ökonomie auf den Faktor Zeit reduzierten Begriff der Arbeit (das heißt die 'abstrakte' Arbeit, die in Arbeitskraft verwandelte konkrete Arbeit) als Analysekategorie wieder in den Blick zu kriegen versuchten, um so „die Arbeit wieder in den Bereich der Wirtschaftsanalyse einzuführen.“[13] Konkretisiert als menschliches Verhalten, das wiederum als eine Beziehung zwischen Zwecken und knappen Mitteln gefasst wird, kann Arbeit auf diese Weise scheinbar umfassender in die (ökonomische) Analyse eingepflegt werden.[14] Arbeit ist im Neoliberalismus keine relationale Sache mehr, sie stellt keinen Vermittlungsaufwand zwischen Prozessen und Dingen mehr dar, sondern wird zu einer Instanz der Überbrückung zwischen Mitteln und Zwecken.
Auf diese Weise kann nun an die Stelle der vormaligen Vorstellung der – abstrakten – Arbeitskraft im Neoliberalismus die Kompetenz als Kapital (als Zusammenführung der Kompetenz der Arbeiter*in mit der davon nicht zu trennenden Arbeiter*in) treten, die ein bestimmtes Einkommen einbringt. Das Einkommen einer kapitalisierten Kompetenz hat somit den Lohn ersetzt. Man sieht, dass die Arbeiter*in Unternehmerin ihrer selbst geworden ist – und als solche ist es nur logisch, dass sie*, wenn sie konsumiert, auch produziert – und jetzt kommt es – nämlich mit Gary Becker nach Foucault zitiert – ihre eigene Befriedigung.[15]
Im neoliberalen Kino ist die Zuschauer*in entsprechend nicht nur Konsument*in, sondern sie ist auch zur Unternehmerin ihrer eigenen Befriedigung geworden. Was aber geschah etwa mit den Kinogänger*innen, die im Kino immer schon unter Beobachtung gestanden haben, wie sie zu Beginn des 20. Jahrhundert von Emilie Altenloh und seither auch vielen anderen beschrieben worden sind? Ist es so, dass Auseinandersetzungen um feministische, antirassistische, anti-koloniale und postkoloniale Aneignungen, Umformungen und Umformatierungen der Weisen, wie bestimmte Subjektivitäten im dominanten kulturellen Bilderrepertoire erscheinen, zu Dearchivierungen geführt haben, zu Herausforderungen des Archiv als epistemologischem Ort der Diskursformation, die nicht nur weiterhin dringlich sind, sondern die anschlussfähiger geworden sind bezüglich allgemeingültiger, pluralisierter und popkultureller Verwendungen?
3.
In der Tat ist es interessant, dass die Filmtheorie immer sehr viel mehr darüber nachgedacht hat, wie es ist, etwas zu sehen (gaze, look, spectator, scopophilia), zuzusehen, Zuschauer*in zu sein, als wie es ist, angeschaut zu werden. – Mir scheint, dass unter den aktuellen Konditionen allerdings Zweiteres entscheidender wird denn Ersteres, und der Boom von so genannten reaction videos ist hierbei wohl eher als ein Symptom für einen tiefgreifenden Wandel des Verhältnisses zwischen Bildschirmen (statt Projektionsflächen) und Subjektivität zu verstehen. Nicht people watching, sondern watching people watch, die Leute beim Zuschauen beobachten, hat Konjunktur.
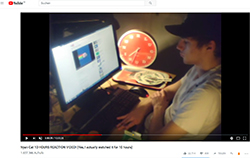
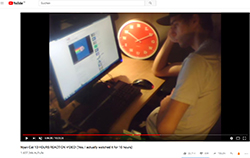

”Nyan Cat 10 HOURS REACTION VIDEO! (Yes, I actually watched it for 10 hours)” hat zur Zeit (11.09.2019) 1.659.556 Aufrufe auf YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=D6etnDBV2gY). “Nyan Cat“ ist eine aus 12 Frames bestehende 8-Bit-GIF-Animation einer fliegenden Katze mit einem Körper, der aus einem Kirsch-Pop-Tart besteht. Die Katze lässt einen Regenbogen hinter sich und im Hintergrund spielt ein Remix des Songs „Nyanyanyanyanyanyanyan!“. Bereits “Nyan Cat“ (https://www.youtube.com/watch?v=QH2-TGUlwu4) war ein so genanntes YouTube-Phänomen, das im Oktober 2011 über 39 Millionen Zugriffe erreichte. Durch seine Popularität entstanden viele neue Remixe und Cover-Versionen, einige darunter mehrere Stunden lang, sowie zahlreiche Apps (siehe etwa auch: http://www.nyan.cat/).
Ich möchte an die berühmte Szene erinnern, in der Frantz Fanon ins Kino geht, um auf sich selber zu warten... – In dem Kapitel „L'expérience vécue du noire“ (die gelebte Erfahrung des Schwarzen) schreibt er: „Impossible d'aller au cinéma sans me rencontrer. Je m'attends. A l'entreacte, juste avant le film, je m'attends. Ceux qui sont devant moi me regardent m'épient, m'attendent. Un nègre-groom va apparaître. Le coeur me tourne la tête.“[16] Unmöglich ins Kino zu gehen, ohne mir selbst zu begegnen. Ich warte auf mich. Während des Pausenfilmes, kurz vor dem Hauptfilm, warte ich auf mich. Diejenigen die vor mir sitzen, schauen mich an, spähen mich aus, ich erwarte mich. Ein schwarzer Hausdiener wird erscheinen. Das Herz verdreht mir den Kopf.[17] Fanons Erfahrung, im Kino angeschaut zu werden, ist eine ganz andere als diejenige, die Altenloh als gültig für junge Frauen in der Frühzeit der Kinos beschrieben hat. Nicht diejenigen, die im Publikum neben ihm sitzen, stören seine Sicht auf Film und Leinwand. Vielmehr hindert ihn, das, was auf der Leinwand erscheint und von denen, die in den Reihen vor ihm sitzen, erspäht wird, daran, Publikum zu sein. Der in der voyeuristischen Schaulust verankerte Kinodiskurs verfehlt ihn, die erforderliche Beziehung zur Alterität dessen, was es zu sehen gibt, misslingt. Deutlich wird ihm daran, dass er nicht über ein „right to look“ (Nicholas Mirzoeff) verfügt, sondern einen „oppositionellen Blick“ (bell hooks) mobilisieren muss, einen, der befragt, auseinandernimmt und Unruhe stiftet. Fanons Kinoerfahrung wird zur komplizierten und schmerzhaften Spirale, sich selbst beim Angeschaut-Werden zuzusehen.
Die Subjekt-Objekt-Unterscheidung zwischen Schauenden und Geschauten, zwischen Zuschauerin und Repräsentation, die für die Kino-Ära samt ihrem in eine spezifische historische soziopolitische Macht-Formation eingebundenen Voyeurismus typisch zu sein scheint[18], ist für die audiovisuellen Apparate des digitalen Zeitalters nicht mehr adäquat. Die aktuellen Maschinen des Sichtbaren operieren weniger individualisierend, normierend und disziplinierend, indem sie sichtbare Körper hervorbringen, als vielmehr identifizierend, inkludierend oder exkludierend, indem sie Sichtbares zerlegen, auseinandernehmen und neu versammeln bzw. zusammensetzen. Fanons Erfahrung, sich beim Angeschaut-Werden zuzusehen, ist zu einer beinahe alltäglichen Kondition geworden. Während der Körper als Erzeuger bewegter Bilder Ende des 19. Jh. verschwand, zugunsten einer maschinellen Vision und einer maschinellen Bewegung, tauchte er dafür umso mehr als Thema oder Motiv des Films auf.[19] Heute, so scheint es, ist der Körper immer bereits Film und im Film. Was zur Disposition steht, ist eher, wie er und als was oder wer er dort wieder herauskommt.
In seinem Text „Wo ist Film (heute)?“ schreibt Malte Hagener: „Der Film ist allgegenwärtig, überall und nirgends zugleich.“[20] Hagener arbeitet heraus, dass Film heute nicht mehr als ein Ding verstanden werden könne, das an ein bestimmtes Trägermedium gebunden sei; Kino könne nicht mehr in Begriffen seiner architektonischen oder (stabilen) institutionellen Rahmung (samt seiner Ökonomien) gefasst werden; Film habe sich deterriorialisiert; er sei zerstreut, flexibel, modular, flüchtig geworden und unsere Wahrnehmung und unser Denken seien kinematographisch geworden.[21] – Außerdem seien wir ins „Zeitalter des Kamerabewusstseins eingetreten, in dem unsere Vorstellungen von Selbst und Welt durch Rahmen bestimmt sind, die der Film und die Medien mit vorgeben.“[22] Hagener spricht von einer Medienimmanenz, die meine, dass wir uns jenseits des klassischen philosophischen Gegensatzes zwischen Ontologie (die Dinge sind außerhalb des Subjektes in der Welt) und Epistemologie (alles verbindet sich im und über das wahrnehmende Subjekt) befinden.
Was uns von der üblichen zeitlichen und räumlichen filmischen Anordnung einer mise-en-scène geläufig ist, ihre Kausalität als Reihenfolge von (vor)filmischer Ursache und (nach)filmischer Wirkung wie Wahrnehmung scheint sich in dieser scène de clôture umgedreht zu haben. Geradezu paradigmatisch scheint mir die Kondition einer kinematographisch geprägten Medienimmanenz und einer gewissermaßen technologisch verkörperten Wahrnehmung in der fast vierminütigen Schluss-Szene von Michael Haneckes Film Caché (2005) angeordnet[23]:
Vor dem Gebäude, nach Schulschluss, Einstellung in der Perspektive der Wartenden, suggeriert die Einstellung einer Überwachungskamera, a-subjektiv, die auf den Ausgang gerichtet ist. Herauskommende treten auf die Treppe heraus wie auf eine Bühne, bloß dass dort kein Stück gegeben wird, es gibt keine Signifikanzen. Viele Handlungen gleichzeitig. Kein klarer Fokus wird nahegelegt. Das was stattgefunden hat, war drinnen und zuvor. Jetzt wird weggegangen. Manche kommen, warten, um mit den Weggehenden wegzugehen.
















Snapshots aus Michael Hanecke, Caché (2005)
Heide Schlüpmann hat das Fotogen-Werden im frühen Kino, das damals viel beschworene photogénie, das die Fähigkeit des Films bezeichnet, Lebendigkeit, Sichtbarkeit oder Schönheit zu steigern,[24] beschrieben als Rücknahme des eigenen Vermögens der Einbildungskraft, als „Rücknahme der Körperführung in die Bewegtheit äußerer Wirklichkeit“ zugunsten ihrer Herstellung im Kino.[25] Auch der Schauspieler, nicht nur die Kamerafrau stelle seinen* bzw. ihren* Körper in den Dienst des Filmemachens. Und das bedeutet, seinen*ihren Leib und sein*ihr Begehren zurückzunehmen, um die Einbildungen anderer Physis entstehen zu lassen. Die Pointe hierbei ist diese: „Mit der Zurücknahme aber geht das Versprechen einer Wiederkehr einher, die in der Aufführung des Films stattfindet. Zur Erscheinung, die die Aufnahme herstellt, gehört daher untrennbar die Aufführung; mit ihr erst tritt die äußere Wirklichkeit der filmischen Erscheinungen hervor (...). Das lässt sich gar nicht genug betonen: Im frühen Kino ist, eine Filmaufnahme zu machen, ohne zugleich deren Aufführung mitzudenken, nicht vorstellbar.“[26] Folgen wir Schlüpmann, so hat der frühe Film die Verbindung zwischen Film und Publikum über die – auch utopische – Imagination hergestellt – und zwar sofern er zum einen untrennbar Aufnahme und Aufführung war und zum anderen sofern aus der Aufführung ein Prozess hervorging, der dem der Aufnahme ähnlich ist: nämlich ein erneuter Einbildungsprozess.[27]
Die Verschlaufung von Filmaufnahme und Filmaufführung, die sich mit dem paradigmatischen Bild von Haneckes Schluss-Szene reflektieren lässt, kann als Echo oder als post-kinematographisch verschobene Metapher bzw. als Metakommentar einer solchen kinematographischen Prozessierung der Imagination verstanden werden: Die Zurücknahme der Körperführung, seine Indienstnahme für und als Film scheint hier allerdings so komplett umgesetzt, dass sich am Ende von Caché die Frage der Imagination gewissermaßen umgekehrt als motiviert und in Gang gesetzt durch die Notwendigkeit, das Bild zu verlassen stellt statt wie in der Frühzeit des Films in dieses einzutreten. Statt sich die Aufführbarkeit des Selbst als double dort im Bild vorzustellen, stellt Hanecke seinem Publikum hier eine Imagination zur Disposition, die den Austritt der doubles aus den Bildern heraus, in denen sie immer schon erscheinen und die vorgängig sind, hinein in eine Aufführung erlaubte. Die Pointe von Haneckes Einstellung ist die Introduktion einer Temporalität des Schauens, das nachträglich kommt, denn die Bildlichkeit, die die Überwachungskamera erzeugt, war bereits da, bevor diese Szene für uns als Publikum sichtbar geworden ist. Um ein Ende des Films, einen Ausgang aus seinem Narrativ, das daraus besteht, dass es etwas verbirgt oder verheimlicht (Caché), imaginieren zu können, müssen wir aus dieser Temporalität austreten, wir müssen das Gesehene aus der filmischen Überwachungsszenerie herauslösen und die Frage der Signifikanz beantworten. Wir müssen die Indifferenz zurücklassen, in der potentiell ‚alle‘ dort, in diesen Bildern, erscheinen, in diesen laufenden Bildern, die bereits seit längerer Zeit den Aufführungs- und Innenraum Kino verlassen haben... Die Imagination (oder die post-kinematographischen Formation) entscheidet sich ausgehend von der Kondition des Gesehen-Werdens als einer Wirklichkeit, die gefangen hält, gestellt.
Wenn Hanecke seinen Zuschauer*innen mit dieser Einstellung vorführt, dass sie selbst es sind, die entscheiden, wen sie auf diesen flachen Bildern in den Blick nehmen, wenn er seine Zuschauer*innen dazu bringt, sich dabei zu beobachten, wie sie beschließen, in dieses indifferente Bild einen Fokus einzuführen, eine Aussagekraft zu produzieren, dann lässt er sie reflektieren über eine Kondition des Gesehen-Werdens, in der die Welt anfängt, Film zu machen, aber auch umgekehrt, in dem der Film anfängt, Welt zu machen und ein neues, potenzielles Existenzfeld hervorbringt,[28] bei dem schwer zwischen Protagonist*innen und Komparsen, zwischen Schauspieler*innen und Passant*innen, zwischen Zusehenden und Angeschauten zu unterscheiden ist. Die Zuschauer*in ist eine einzelne in einer Vielheit; anders als bei der audience development, wo die Imagination in der Form von Zuschauer*innen-Profilen aus den vernetzten Screens der digitalen Kultur herauszurechnen versucht wird, lässt sich das Publikum, als das die Zuschauer*in sich in dieser Schlusseinstellung Haneckes gespiegelt sieht, nurmehr als ein – niemals unschuldiges, kontingentes – Zusammenwirken dieser Vielheit im entgrenzten Raum einer sich beim Zusehen zusehender Zuschauer*innenschaft unter den technischen und technologischen Bedingungen der Überwachung im digitalen Zeitalter verstehen.
---
[1] In diesen Kinos sei das Publikum noch ein kommunizierendes Kollektiv gewesen, schreibt Klas Kreimeier. In diesen frühen Laden- und Kneipenkinos gab es nämlich keine festen Stuhlreihen, sondern ein Laufpublikum; man kommt und geht, unterhält sich während der Vorstellungen laut, isst trinkt und raucht etc. Vgl. etwa Klaus Kreimeier (2014), „Entfesselung und Steuerung - Blickstrategien in der frühen Kinematografie“, in: Heinz-Peter Preußer (Hg.), Anschauen und Vorstellen: gelenkte Imagination im Kino, Marburg: Schüren, 33-51
[2] Emilie Altenloh (2012), Zur Soziologie des Kino: Die Kino-Unternehmung und die sozialen Schichten ihrer Besucher, neu herausgegeben von Andera Haller, Martin Loiperdinger und Heide Schlüpmann, Frankfurt am Main: Stroemfeld, 94.
[3] Bodo Kensmann (2000), „Film – Wirklichkeiten“, in: Claus Urban und Joachim Engelhard (Hg.), Wirklichkeit im Zeitalter ihres Verschwindens, Münster/Hamburg/London: Lit Verlag, 104.
[4] In der Lichtbild-Bühne Nr. 112 vom 17. September 1910 stellte etwa Arthur Mellini den ethischen und erzieherischen Wert des Kinos heraus, dem er sogar die Lösung der sozialen Frage zutraute. In seinem unter dem Titel „Die Erziehung der Kinobesucher zum Theaterpublikum“ veröffentlichten Text beschreibt er, man habe inzwischen dem Publikum nicht nur beigebracht habe, wo man hinschauen solle sondern auch, wie das Schauen zu genießen sei.
[5] Heide Schlüpmann (2007), Ungeheure Einbildungskraft. Die dunkle Moralität des Kinos, Stroemfeld, 279.
[6] Ebd., 281.
[7] Ebd.
[8] Ebd., 284.
[9] Alvin Toffler, The Third Wave, 1980, deutsch: Die Zukunftschance: Von der Industriegesellschaft zu einer humaneren Zivilisation, München 1980.
[10] Mit semiprofessionell meine ich hier vor allem, dass in die Produkte weder hohe Produktionsgelder einfließen noch hohe Gewinnmarschen bezogen werden können.
[11] „Neurocinematics“ ist ein Begriff, den Uri Hasson, Psychologieprofessor an der Universität Princeton prägte. Hierbei geht es um eine Ausmessung der Biodaten des Publikums. Neurocinema wäre eine Kino- und Kulturform, die algorithmisch ihr Publikum (er-)findet.
[12] Vgl. hierzu exemplarisch etwa die Bewegung der EuroMayDays (2001 ff.) und „kpD, kleines postfordistisches Drama“ (2004).
[13] Michel Foucault, „Vorlesung 9 (Sitzung vom 14. März 1979)“, in: Ders., Die Geburt der Biopolitik. Geschichte der Gouvernementalität II, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2006, 300-330, hier 307.
Foucault hierzu über Marx, dass dieser genau dies zeige, nämlich dass die Logik des Kapitals die Arbeit auf die Zeit und die Kraft reduziere. Wo aber Marx den Fehler beim Kapitalismus identifiziert, bei der Logik des Kapitals und seiner historischen Wirklichkeit, sehen die Neoliberalen den Fehler in der ökonomischen Theorie, die man über die kapitalistische Produktion aufgestellt hat. Foucault, der eher keine Klassenkämpfe in den Blick nimmt, die historischen Dynamiken der Auseinandersetzungen zwischen lebendiger Arbeit und Kapital, wenn man so will, völlig ausblendet, induziert aber sehr richtig diese entscheidende Verlagerung der Auseinandersetzung auf den Diskurs – er spricht von der theoretischen Kritik über die Art und Weise wie Arbeit im ökonomischen Diskurs selbst abstrakt wurde. (309) – Der Neoliberalismus, so Foucaults Diagnose, modifizierte den allgemeinen Bezugsrahmen der ökonomischen Analyse.
[14] Ebd., 310.
[15] Ebd. 315.
[16] Zitiert nach Frantz Fanon (1952), Peau noire, masques blancs, elektronische Ausgabe, bestellt durch Émilie Tremblay, Université de Montréal, 2008, 148.
[17] Von mir modifizierte Übersetzung des von Eva Moldenhauer übertragenen Textes. Groom heißt Stallbursche, Knecht, Diener, Page, Entertainer, aber auch Bräutigam. Entreactes sind Pausenfilme, kurze Unterhaltungsfilme. Ganz klar wird mit dem Ausdruck nègre-groom auf Französisch jenes Bilderrepertoire auch des bewegten Bildes aufgerufen, das vom Stereotyp des unterwürfigen Haussklaven bis zur lächerlichen Witzfigur des minstrel entertainers reicht. In Kolonialdeutsch gab es den verwandten Begriff des „Hosenniggers“ für als lächerlich dargestellte Schwarze in den Kolonien, die sich nach westlicher Art kleideten.
[18] Vgl. Catherine Zimmer, Surveillance Cinema, New York University Press, 2015.
[19] Lev Manovich, „Digital Cinema and the History of a Moving Image“, in: Leo Braudy und Marshall Cohen (Hg.), Film Theory and Criticism. Introductory Readings, New York: Oxford University Press, 794-801, hier 797.
[20] Malte Hagener, „Wo ist Film (heute)? Film / Kino im Zeitalter der Medienimmanenz, in: Gudrun Sommer, Vinzenz Hediger, Oliver Fahle (Hg.), Orte filmischen Wissens. Filmkultur und Filmvermittlung im Zeitalter digitaler Netzwerke, Marburg (Schüren) 2011, 45-59.
[21] Hier ließe sich natürlich eine ganze kulturhistorische Auseinandersetzung zu (kinematographischen) Wahrnehmungsapparaten und Körpertechnologien anschließen, etwa mit Bernard Stieglers „ästhetischen Konditionierung“, die mit der Einführung der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien verbunden sei, Marcel Mauss‘ „Techniken des Körpers“ oder Walter Benjamins Überlegungen zur historischen Veränderung der Sinneswahrnehmung.
[22] Hagener, „Wo ist Film (heute)?“, 52.
[23] 1:49:20 bis 1:53:15.
[24] Das photogénie, wurde vor allem von Jean Epstein theoretisiert als Fähigkeit einer filmischen Erscheinung, sich zugleich in der Zeit und im Raum zu bewegen und zu verändern. Ihre maximale Dauer lag bei Epstein unter einer Minute.
[25] Schlüpmann (2007), Ungeheure Einbildungskraft, 260.
[26] Ebd., 255-256.
[27] Schlüpmann differenziert diesen Kreislauf der Imagination insofern, dass es mit der Institutionalisierung des Kinos und einer zunehmenden Professionalisierung mehr und mehr die Aufführung werde, die die Imagination in Gang setze und die Provokation der Imagination durch die Aufnahme in die Nachträglichkeit versetze.
[28] Vgl. Brigitta Kuster (2018), Grenze filmen, Bielefeld: transcript, vor allem das zweite Kapitel.

